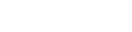„Importierter Antisemitismus“!? – Ein irreführendes Schlagwort mit weitreichenden Folgen
ReflAct - Unterstützung von Vereinen im Umgang mit Antisemitismus
Juli 2025[1]
Gleich zu Beginn: Einen importierten Antisemitismus gibt es nicht. Nichtsdestotrotz geistert der Begriff seit Jahren durch die Medien und die Öffentlichkeit – gerne als strategisch eingesetztes Schlagwort in der Politik, mit weitreichenden Folgen.
Im Juni 2025 behauptete Bundeskanzler Merz in einem Interview mit den US-amerikanischen Fox News: „Wir haben eine Art importierten Antisemitismus mit dieser großen Anzahl von Migranten, die wir in den letzten zehn Jahren haben.“[2] Er war nach den Gründen für den Anstieg antisemitischer Vorfälle in Deutschland gefragt worden. Weitere Aussagen machte er zu dieser Frage nicht.
Seit ungefähr zehn Jahren erfährt die Import-These im Zusammenhang mit antisemitischer Gewalt und Hassrede eine zunehmende Prominenz in Politik und Medien. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem anhaltenden Anstieg antisemitisch motivierter Gewalt seitdem scheint die ‚Debatte‘ darum, ob es sich hierbei um ein importiertes Problem handele, stets mitzuschwingen. Dabei bleibt die Begriffsklärung erstaunlich schwammig – wer genau wird als vermeintliche*r Importeur*in ausgemacht? Und soll damit suggeriert werden, dass es ohne ‚Import‘ keinen Antisemitismus in Deutschland gäbe?
Was sagt die Wissenschaft?
Eine ausführliche Begriffsklärung findet sich nicht in der medialen Öffentlichkeit und auch nicht in den Aussagen von Politiker*innen, dafür aber in wissenschaftlichen Untersuchungen, welche die Implikationen der Import-These empirisch betrachten:
„Der Begriff des „importierten Antisemitismus“ suggeriert, „Antisemitismus in erster Linie eine Konsequenz von Einwanderung sei und quasi mitmigriert“ (Öztürk und Pickel 2022, S. 212). Die Verwendung des Begriffs steht für die Annahme, dass der zurzeit in Deutschland herrschende Antisemitismus auch, wenn nicht sogar primär, auf die Einwanderung von Migrantinnen und Migranten aus muslimischen Ländern zurückgeführt werden kann, die antisemitische Denkmuster aus ihren Herkunftsländern mit nach Deutschland bringen. Die Gegenposition kritisiert diese Annahme dagegen als Teil rassistischer Diskurse gegenüber Muslimas und Muslimen und als Abwehrreaktion der extremen Rechten gegenüber Antisemitismusvorwürfen.“[3]
Hierbei ähnelt die Verwendung der Import-These in ihrer Funktionsweise der häufig bemühten und rassistisch aufgeladenen Behauptung, schwere Gewalttaten würden hauptsächlich von (muslimischen) Migrant(*in)en verübt.
Und obwohl beide Aussagen klar widerlegt wurden, halten sie sich beharrlich. Sie haben reale Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Diskurs, auf die Personen’gruppen‘, welche so kollektiv beschuldigt werden, ebenso wie auf die Bildungsarbeit und politische Entscheidungen.
Statistiken zeigen: So wenig, wie die Begriffe ‚migrantisch‘ und/oder ‚muslimisch‘ alleine oder gemeinsam sinnvolle wissenschaftliche Kategorien bilden[4], so wenig lässt sich empirisch ein fester Zusammenhang zwischen Migrationsbewegungen und dem Anstieg von Antisemitismus belegen. Es wurde allerdings mehrfach aufgezeigt, dass „keine gesellschaftliche Gruppe vor Antisemitismus gefeit [ist], unabhängig von Herkunft, Einkommen, Bildungsgrad oder anderen Faktoren. Und: Antisemitismus ist ein Evergreen in Deutschland – seine Geschichte reicht jahrhunderteweit“ zurück[5]. Untersuchungen zeigen zudem, dass die (volle oder teilweise) Zustimmung der Deutschen zu antisemitischen Aussagen in den letzten Jahren bei bis zu 20% liegt – und dass diese in Bezug auf einige Formen des Antisemitismus steigt[6].
Die wenigen Untersuchungen, die sich tatsächlich der Frage widmen, ob und wie sich Migrationserfahrung, eine andere Staatsangehörigkeit als die deutsche und eine muslimische Religionszugehörigkeit auf die Entwicklung antisemitischer Einstellungen (in Deutschland) auswirken, kommen zu gemischten Ergebnissen: „Je nachdem, welche Ausprägung des Antisemitismus man sich anschaut, weisen Personen mit Migrationshintergrund und Muslim*innen höhere oder geringere antisemitische Einstellungen auf als Personen ohne Migrationshintergrund und Nicht-Muslim*innen.“[7] Erhellender kann es an dieser Stelle sein, einen Blick auf die jeweiligen antisemitischen Prägung verschiedener Gruppen zu werfen um aus diesen mögliche Handlungsansätze abzuleiten[8].
Die Behauptung eines Antisemitismus-Imports – so wenig sich diese auch in der Realität nachweisen lässt – wird zudem nicht einmal vordergründig dazu genutzt, die Prävention oder Bekämpfung von Antisemitismus unter bestimmten (konstruierten) Personengruppen zu fördern. Sie dient einzig als rhetorisches Mittel der Ablenkung von einem gesamtgesellschaftlich verbreiteten Problem, welches zudem noch die gefährliche und falsche Implikation in sich trägt, (muslimische) Migrant*innen seien die größte (wenn nicht die einzige) Gefahr für Jüdinnen*Juden in Deutschland.
Was halten Jüdinnen*Juden von der Import-These?
Bezeichnenderweise gibt es relativ wenige Untersuchungen und Aussagen dazu, wie diejenigen, die konkret von Antisemitismus betroffen sind, zur Import-These stehen. In Interviews geben Befragte allerdings an, dass diese keine maßgebliche Rolle in der innerjüdischen Auseinandersetzung um Antisemitismus spielt, denn: „Jüdinnen und Juden kommen in diesem Streit, der innerhalb der nicht- jüdischen Mehrheitsgesellschaft geführt werde, nicht als Akteure und Subjekte vor, sondern oftmals als bloße Instrumente, die für linke und rechte Akteure aus Eigennutz herangezogen werden. Wird „importierter Antisemitismus“ als gesellschaftlich geführte Debatte gedeutet, herrschen demgemäß vor allem enttäuschte und resignative Perspektiven vor, die die Debatte oftmals als unproduktiv und im Angesicht eines allseitigen Antisemitismus als wenig zielführend kritisieren“[9]. Die Diskussion wird außerdem als sehr polarisiert wahrgenommen. Die Interviewten kritisieren sowohl rechte Akteur*innen für die Instrumentalisierung von Jüdinnen*Juden für eine Propagierung von antimuslimischem Rassismus und die Verschleierung eigener Ressentiments sowie des Unwillens, tatsächlich gegen Antisemitismus tätig zu werden. Linke Positionen hingegen negieren nach Ansicht der Befragten sowohl den Antisemitismus in progressiven Teilen der Gesellschaft, als auch denjenigen in migrantischen Communities, was ebenfalls einer ernsthaften Bekämpfung von Antisemitismus im Wege stehe[10].
Der Begriff selbst wird allerdings auch in der jüdischen Community in Deutschland verwendet, jedoch eher, um auf diejenigen Formen des Antisemitismus aufmerksam zu machen, die maßgeblich durch den politischen Islam und/oder Staaten, die Israel bekämpfen, gefördert werden und sowohl Propaganda und Hass gegen Israel als jüdischen Staat verbreiten, als auch klassische antisemitische Weltverschwörungsideologien gegen Jüdinnen*Juden befeuern.
Dabei bemühen sich die Befragten um eine differenzierte Erklärung für diese Erscheinungen, indem beispielsweise das Staatsfernsehen oder das Schulsystem einiger arabischer Staaten als Katalysatoren für offenen Antisemitismus als Staatsdoktrin genannt werden. Als mögliche Gründe dafür, dass die so geprägten Stereotype und ggf. auch der Hass auf Israel auch innerhalb arabischer Communities in Deutschland beibehalten werden, benennen einige Jüdinnen*Juden den starken Rassismus gegenüber arabischen und/oder muslimischen Menschen in Deutschland, der dazu führe, dass diese sich eher in der eigenen Community bewegten und u. a. Medien aus ihrer (oder der familiären) Herkunftsregion nutzten, welche islamistisch geprägt sind. Die befragten Jüdinnen*Juden erachten somit den erlebten Ausschluss von Muslim*innen/Menschen aus arabischen Ländern in Deutschland als möglichen Nährboden für das Beibehalten und Generieren von Feindbildern.
Eine ähnliche Funktion schreiben die Interviewten auch einer eigenen oder familiären Prägung von Menschen aus dem Nahen Osten zu, die auf verschiedenste Weisen vom Nahost-Konflikt und Gaza-Krieg betroffen sind. Diese führe in der Konsequenz zu einer Ablehnung oder Infragestellung Israels als Staat, was wiederrum ein Einfallstor für Antisemitismus biete.
Ich halte diesen Ansatz für einen reflektierten und einzig sinnvollen Umgang mit der Import-These[11], da hier mögliche individuelle und gruppenbezogene Hintergründe für die Entstehung, Verbreitung und Kultivierung antisemitischen Gedankenguts in bestimmten arabisch-muslimisch geprägten Communities benannt werden, die in der öffentlichen Diskussion normalerweise fehlen. Zugleich fungieren all die hier genannten Erklärungen für die Entstehung von Antisemitismus natürlich nicht als dessen Legitimierung, sondern können wertvolle Ansätze dafür liefern, um in der Arbeit gegen Antisemitismus eine Vielfalt von familiären, geographischen und politischen Einflüssen und Betroffenheiten mitzudenken.
Ein ähnlicher Ansatz wäre ebenso wünschenswert, wenn über die Antisemitismus-Prägung anderer gesellschaftlicher Gruppen in Deutschland gesprochen wird, mit der Prämisse, dass die gesamte Gesellschaft von Antisemitismus durchzogen ist, sich die jeweiligen Bezüge und Ausdrucksarten jedoch – je nach Hintergrund – unterscheiden. So wäre es beispielsweise erhellend, im Kontrast zur Import-These die Tatsache zu beleuchten, dass in der „deutschen Gesellschaft (…) Antisemitismus zwar weiterhin verbreitet, aber offiziell tabuisiert [ist]. Wenn Menschen hier wohnen und aufwachsen, lernen sie dieses „Einhalten der sozialen Norm gegen Antisemitismus““[12]. Dies kann u. a. dazu führen, dass beispielsweise der Antisemitismus Deutscher ohne Migrationsgeschichte weniger ‚laut‘ nach außen getragen oder von diesen selbst negiert wird – was eine gefährliche Leerstelle in der Bekämpfung von Antisemitismus darstellt und es sehr viel leichter macht – siehe die Aussage von Friedrich Merz bei Fox News – ein gesamtgesellschaftliches Problem auf eine marginalisierte Gruppe zu projizieren.
Folgen und Perspektiven für die Bildungsarbeit
Antijudaismus und Antisemitismus sind uralte, teils religiös geprägte Verschwörungserzählungen, die je nach historischem, politischen, geographischen Kontext eine enorme Anpassungsfähigkeit beweisen. Dies geschieht mit dem Ziel, komplexe Sachverhalte vermeintlich erklärbarer und erträglicher zu machen, die ‚Schuldigen‘ auszumachen und oftmals auch Gewalt und Vernichtung zu legitimieren. Eine Aufgabe für politische Bilder*innen, die sich mit der Prävention und Bekämpfung von Antisemitismus beschäftigen, ist es zunächst, diesen Sachverhalt je nach Zielgruppe angemessen und anhand historischer und aktueller Beispiele zu vermitteln. Ein weiterer, meines Erachtens bisher weniger stark fokussierter Bestandteil der Vermittlungsarbeit ist es, die jeweils eigene (familiäre, gesellschaftliche) Betroffenheit[13], bzw. antisemitische Prägung zu reflektieren, ebenso wie die verschiedenen Hintergründe der Adressat*innen miteinzubeziehen – jedoch ohne diese bloß zu vermuten.
Was bedeutet dies konkret? In der Bildungsarbeit treffen, wie in der gesamten Gesellschaft, viele verschiedene Bezugspunkte und persönliche Auseinandersetzungen zum Thema Antisemitismus aufeinander[14]:
- Deutsche ohne jüdische oder Migrationsgeschichte, deren Bezugspunkt zum Antisemitismus die Shoah und der Nationalsozialismus sind (und die wahrscheinlich mit der Erzählung vom „Aufarbeitungs-Weltmeister“ Deutschland aufgewachsen sind): Diese Gruppe hat häufig wenig Bezug zu heutigem jüdischen Leben in Deutschland und kann Schwierigkeiten haben, aktuellen Antisemitismus zu erkennen – oder die Notwendigkeit, dagegen vorzugehen. Unbearbeitete bzw. tabuisierte antisemitische Prägungen können zu einer (unbewussten) Projektion dieser auf den Gaza-Krieg führen, ebenso wie zu einer Dämonisierung Israels und einer Gleichsetzung der israelischen Kriegsführung mit dem nationalsozialistischen Deutschland.
- Personen mit Migrationsgeschichte, die keinen biographischen Bezug zur Shoah oder der deutschen Täter*innengesellschaft haben. Ebenso Migrant*innen ohne geographischen und politischen Bezug zum Nahostkonflikt und/oder politischen Islam: Diese Voraussetzungen können möglicherweise dazu führen, dass dem gesamten Themenkomplex Antisemitismus (in der deutschen Gesellschaft) wenig Sensibilität und/oder Interesse entgegengebracht wird.
- Jüdinnen*Juden aus unterschiedlichen Kontexten, u.a. mit/ohne Israelbezug, Migrations- oder Verfolgungsgeschichte: (Reale) Jüdische Personen als Betroffene werden in der mehrheitsgesellschaftlichen Debatte um Antisemitismus oftmals nicht mitgedacht oder instrumentalisiert. Aufgrund ihrer Erfahrungen ziehen sich viele Betroffene aus diesen Kontexten zurück oder thematisieren ihre Identität und Sichtweisen aus Sicherheitsgründen nicht in mehrheitsgesellschaftlichen Settings.
- Menschen mit biographischem oder geographischem Bezug zu Palästina/zum Nahostkonflikt, Personen mit Prägung durch den politischen Islam und/oder Staaten, die Israel bekämpfen: Religiös geprägter Antijudaismus und eine Dämonisierung Israels als (jüdischen) Staat bzw. antisemitische islamistische Propaganda schaffen und festigen antisemitische Feindbilder, welche teilweise auf den Nahost-Konflikt projiziert werden. Eigene Betroffenheiten durch das Kriegsgeschehen in Gaza können sich in Hass auf Israel äußern.
All diese und viele andere Prägungsmöglichkeiten in Bezug auf Antisemitismus, Betroffenheit durch den Gaza-Krieg oder andere Konflikte im Nahen Osten treffen in der deutschen Gesellschaft und Öffentlichkeit aufeinander. Aufgabe einer pluralistischen Bildungsarbeit, welche strukturelle Diskriminierung intersektional mitdenkt, ist (oder wäre) es, all diese Perspektiven und Hintergründe als gleichwertige Ausgangspunkte für eine Auseinandersetzung mit Antisemitismus zu betrachten.
Denn Leerstellen, Konflikte und Schuldzuweisungen an Andere entstehen dort, wo die eigene (Nicht-)Betroffenheit unreflektiert als Norm gesetzt wird. In der bildungsvermittlenden Praxis kann sich dies beispielsweise so äußern[15]:
- „Wir hatten hier (im Verein) noch nie mit Antisemitismus zu tun. Das Problem haben wir nicht.“ Eine solche Aussage verkennt die Dimension von Antisemitismus als gesamtgesellschaftliche Erscheinung und kann ein Ausdruck von Abwehr und Tabuisierung des Themas sein.
- „Ich habe in meiner Schulklasse viele muslimische Schüler*innen. Ich bin nicht sicher, wie wir den Workshop zu jüdischem Leben konfliktfrei durchführen können.“ Projektion von Antisemitismus auf eine vermeintlich ‚problematische‘ Gruppe macht die Vielfalt von Perspektiven, Betroffenheiten und antisemitischen Prägungen unsichtbar. Diese Sichtweise kann Überschneidungen zur Import-These aufweisen.
- „Die Jugendlichen in unserem Jugendclub sind primär von Rassismus betroffen, da liegt unser Fokus.“ Abstufung zwischen vermeintlich mehr oder weniger relevanten Diskriminierungsarten ist nicht nur im Bildungsbereich wenig sinnvoll kann u.a. Betroffene von Antisemitismus unsichtbar machen und zusätzlich gefährden.
All diesen Beispielen ist neben den genannten problematischen Implikationen und Folgen gemein, dass sie eine sehr vermeidende Position bezüglich der Auseinandersetzung mit Antisemitismus einnehmen. Wenn Bildungsvermittler*innen und Multiplikator*innen die eigene Positionierung in Bezug auf Antisemitismus (und andere Diskriminierungsformen) nicht reflektieren, Zuschreibungen vornehmen und Schuldabwehr-Mechanismen, wie die Import-These, übernehmen, kann weder pluralistische Bildungsarbeit auf Augenhöhe stattfinden, noch eine ernsthafte Prävention und Bekämpfung von Antisemitismus mit all seinen Facetten. Dasselbe gilt für eine Umgehung der Thematik oder das Ausbleiben einer klaren Positionierung gegen jede Form des Antisemitismus, um antizipierte Konflikte zu vermeiden.
Wünschenswert wäre ein Standard in der (politischen) Bildungsarbeit, der Bezug auf alle Formen des Antisemitismus nimmt, die in der deutschen Gesellschaft virulent sind und dabei, je nach Zielgruppe, die jeweiligen Einfallstore für antisemitische Stereotype und Strategien dagegen fokussiert. Ebenso essentiell wäre hierbei, dass Vermittler*innen rassistische Stereotype, Zuschreibungen und Abwehrmechanismen, ebenso wie Emotionen, die bei der Auseinandersetzung mit der Thematik entstehen (können), gleichberechtigt mitdenken und thematisieren[16].
Der aktuell immer sichtbarer werdende Antisemitismus ist nicht importiert. Er ist bloß einerseits in seiner Vielfalt deutlicher und lauter geworden im Kontext des aktuellen Gazakriegs. Zugleich findet er Zuspruch und Anschluss an tradierte unbearbeitete antisemitische Denkweisen in einer Gesellschaft, die Antisemitismus traditionell eher beschweigt, anstatt ihn zu bekämpfen.
[1] Dieser Text entstand auf Grundlage meines Vortrags bei der Bildungswerkstatt „Rassismus- und Antisemitismuskritik zusammen_denken“ der LAG pokuBi e. V. am 16. Juni 2025 in Dresden.
[2] Original-Zitat auf Englisch (Grammatik-Fehler, wie im Original). Zit. nach Deutschlandfunk (06.06.2025): https://www.deutschlandfunk.de/merz-weist-im-fox-news-interview-kritik-wie-von-jd-vance-zurueck-und-spricht-ueber-importierten-anti-100.html (Zugriff am 15.07.2025)
[3] Zit. nach Beyer, H. u. a. (2024), „Importierter Antisemitismus“? In: Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, 8/2024, S. 16
[4] Abgesehen davon, dass beide Begriffe jeweils äußerst heterogene ‚Gruppen‘ umfassen, stellen sich hier beispielsweise ebenso Fragen danach, wer genau (und wie lange) als migrantisch gilt, ob muslimisch als Religionszugehörigkeit oder als kultureller Rahmen verstanden wird oder eine Fremdzuschreibung ist - und vieles mehr. Zudem gibt es bisher nicht allzu viele Untersuchungen, die statistisch einzig den Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Migrationserfahrung (aus muslimisch geprägten Ländern) untersuchen – vermutlich, weil dies wenig sinnvoll ist.
[5] Zit. nach https://nichts-gegen-juden.de/der-aktuelle-antisemitismus-ist-ein-importierter/, (Zugriff am 17. Juli 2025)
[6] Vgl. Arnold, S. (20.08.2024), Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft, https://www.bpb.de/themen/antisemitismus/dossier-antisemitismus/321722/antisemitismus-in-der-migrationsgesellschaft/(Zugriff am 17. Juli 2025). Vgl. außerdem die Ergebnisse der MEMO-Studie von 2025: https://www.stiftung-evz.de/was-wir-foerdern/gedenkanstoss-memo-studie/ (Zugriff am 17. Juli 2025): Antisemitismus ist in allen gesellschaftlichen Gruppen hoch: 25,9 % geben an, Juden nutzten die Erinnerung an den Holocaust zu ihrem persönlichen Vorteil aus. Zum ersten Mal seit Beginn der Memo-Studienreihe ist die Gruppe der Befragten, die der Forderung nach einem "Schlussstrich" unter die NS-Zeit zustimmen (38,1 %), größer als die Gruppe der Ablehnenden.
[7] Zit. nach. Arnold, S. (April 2023), Antisemitismus unter Menschen mit Migrationshintergrund und Muslim*innen, https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/MEDIENDIENST-Expertise_Antisemitismus_unter_Menschen_mit_Migrationshintergrund_und_Muslimen.pdf
(Zugriff am 17. Juli 2025). Dabei gibt es bei klassischem Antisemitismus keine klaren Ergebnisse in Bezug auf Migrant*innen, Muslim*innen weisen allerdings allgemein höhere Zustimmungswerte zu klassischem Antisemitismus auf als Nicht-Muslim*innen.
Sekundärer Antisemitismus ist unter Menschen ohne Migrationserfahrung stärker verbreitet als unter Migrant*innen. Die Religionszugehörigkeit macht hier keinen Unterschied.
Israelbezogener Antisemitismus ist unter Personen mit Migrationserfahrung und Muslim*innen weiter verbreitet als unter Menschen ohne Migrationserfahrung und Nicht-Muslim*innen. Die Studien wurden vor dem 7. Oktober 2023 zusammengetragen.
[8] So steht die Verbreitung des sekundären Antisemitismus unter Deutschen in Zusammenhang mit der „Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte, der familiären Involvierung in der NS-Zeit und der deutschen Identität und gewaltvollen Geschichte“, was zur Abwehr, Leugnung und Schlussstrich-Denken unter Menschen ohne Migrationsbiographie führen kann, ebenso wie zu einer Dämonisierung Israels. Die Autorin des oben genannten Papiers plädiert auch dafür, v.a. geographisch nach der Herkunftsregion der „muslimisch geprägten“ Menschen zu unterscheiden sowie zu beachten, in welchen Herkunftsländer ein staatlich propagierter Antizionismus oder der politische Islam prägend sind, die Einfallstore für klassischen und israelbezogenen Antisemitismus darstellen können. (Vgl. ebd., S. 5 ff.)
[9] Zit. nach Beyer, H. u. a. (2024), „Importierter Antisemitismus“? In: Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, 8/2024, S. 20. Das Forschendenteam hat mithilfe eines Mixed Methods Ansatzes (durch quantitative und qualitative Befragungen) eine Studie zu Perspektiven in Deutschland lebender Jüdinnen*Juden zum politisch-islamischen Antisemitismus sowie zur gesellschaftlichen Debatte um „importierten Antisemitismus“ durchgeführt.
[10] Vgl. ebd., S. 19 f.
[11] Ich verwende hier den Ausdruck um zu zeigen, dass es nicht der Antisemitismus als solcher ist, der von (bestimmten) Migrant*innen/religiösen Gruppen nach Deutschland ‚gebracht‘ wird, sondern dass dieser sich einzig in der Prägung und im individuellen Zugang vom Antisemitismus nicht-muslimischer Deutscher ohne Migrationserfahrung unterscheidet – und nicht in der Art.
[12] Zit. nach. Arnold, S. (2023), S. 6.
[13] Hiermit meine ich nicht in erster Linie Jüdinnen*Juden/Personen mit jüdischer Familiengeschichte, da sich diese zwangsläufig häufiger mit Antisemitismus und der eigenen Betroffenheit auseinandersetzen.
[14] Diese unvollständige Aufzählung beinhaltet schematisch beschriebene ‚Gruppen‘, um das Spektrum verschiedener Zugänge zum Thema Antisemitismus aufzuzeigen.
[15] Die hier genannten Beispiele können Bildungsvermittelnden so oder ähnlich im Kontext der Arbeit gegen Antisemitismus im Projekten und Netzwerken begegnen.
[16] Das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA) hat ein sehr empfehlenswertes Methodenhandbuch herausgebracht, welches dabei helfen kann, Antisemitismus und Rassismus in der Bildungsarbeit zusammenzudenken und zu thematisieren: IDA e. V. (2025): Antisemitismuskritik und Rassismuskritik in der Bildungsarbeit verbinden,
https://www.idaev.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/Reader/2025_AntisemitismusAntirassismuskritik.pdf (Zugriff 28.07.2025)